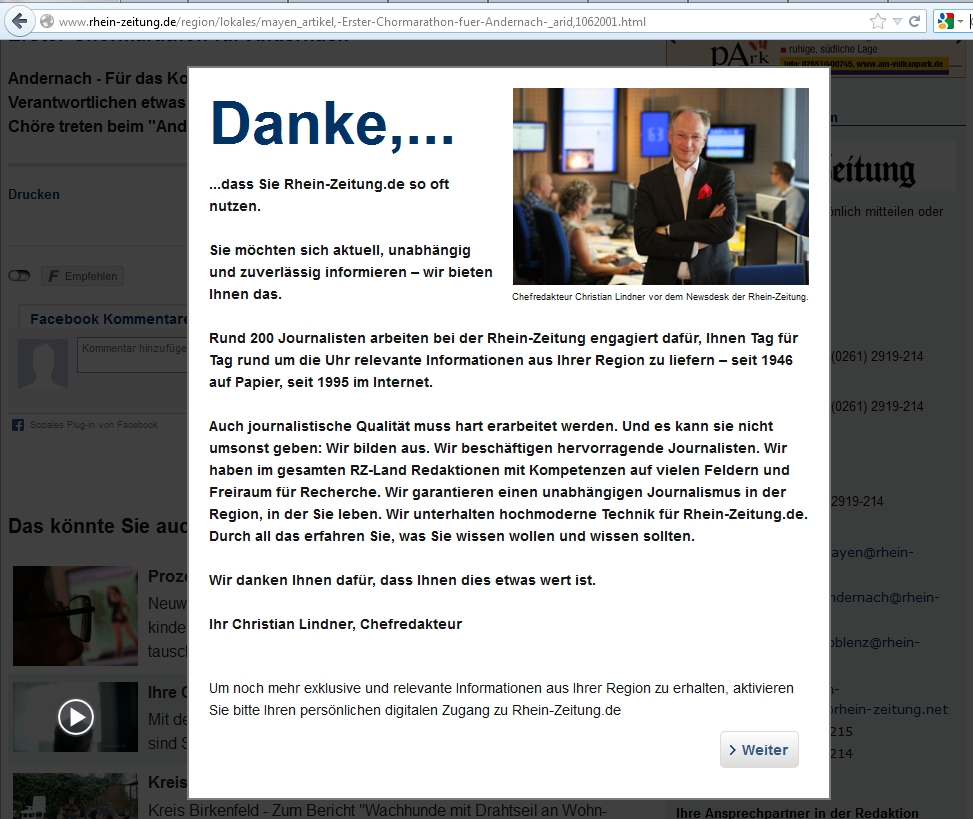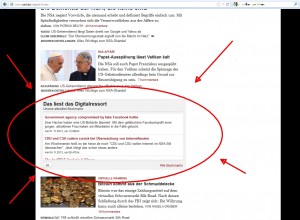Eigentlich ist das, was Facebook mit seinem „Facebook Newswire“ gerade macht, einfach nur konsequent: Inhalte mit Nachrichtenwert, die „sowieso“ von Nutzern auf der Seite gepostet werden, bekommen über diesen Weg den Zugang zu einem wesentlich größeren Publikum. „Kleiner“ Nebeneffekt: Es ist ein weiterer Nagel im Sarg von Nachrichtenmedien. Und das hat folgende Gründe:
Eigentlich ist das, was Facebook mit seinem „Facebook Newswire“ gerade macht, einfach nur konsequent: Inhalte mit Nachrichtenwert, die „sowieso“ von Nutzern auf der Seite gepostet werden, bekommen über diesen Weg den Zugang zu einem wesentlich größeren Publikum. „Kleiner“ Nebeneffekt: Es ist ein weiterer Nagel im Sarg von Nachrichtenmedien. Und das hat folgende Gründe:
- Durch die schiere Masse seiner User und die schiere Größenordung seiner Verbreitung hat Facebook fast automatisch Zugriff auf alle Inhalte, die potenziellen Nachrichtenwert haben.
- Die immer weiter fortschreitende mobile Nutzung des Dienstes sorgt zusätzlich dafür, dass von so gut wie allen Ereignissen Bilder oder Videos vorhanden sind
- Die ausgefeilten Mechanismen zur Einschätzung des User-Interesses in Verbinung mit dem Aufenthaltsort des Users sowie seiner im Profil hinterlegten Interessen erlauben eine genaue Steuerung im Hinblick darauf, wer welche „Nachrichten“ zu sehen bekommt.
- Die Möglichkeit, die Beiträge zu liken, zu teilen und sie einzubetten sorgt für weiter verbesserte Filter und nochmal zusätzliche Verbreitung.
- Facebook holt seine User dort ab, wo sie eh schon sind – nämlich auf Facebook. Im Unterschied zu den Beiträgen „echter“ Nachrichten-Sites wie z. B. Spiegel online muß ich nirgends mehr klicken und auf keine andere Seite mehr gehen.
Interessant finde ich auch (s. Beispiel), dass Facebook für den neuen Dienst offenbar ein Team im Einsatz hat, dass sich bemüht, den „Roh-Content“, in meinem Beispielfall das Video aus der Überwachungskamera, quasi noch nachrichtentechnisch zu „veredeln“, indem man in den Beitrag die Facts zum jeweiligen Ereignis hineinschreibt. In meinem Beispiel ist das etwa die Zahl der Opfer sowie die Quelle, von der die Opferzahl kommt. Das ist – leider, aus Sicht der klassischen Medien – schon ziemlich gut gemacht und man wird sich als Spiegel Online oder ähnliches Medium dringend eine Strategie dagegen überlegen müssen.