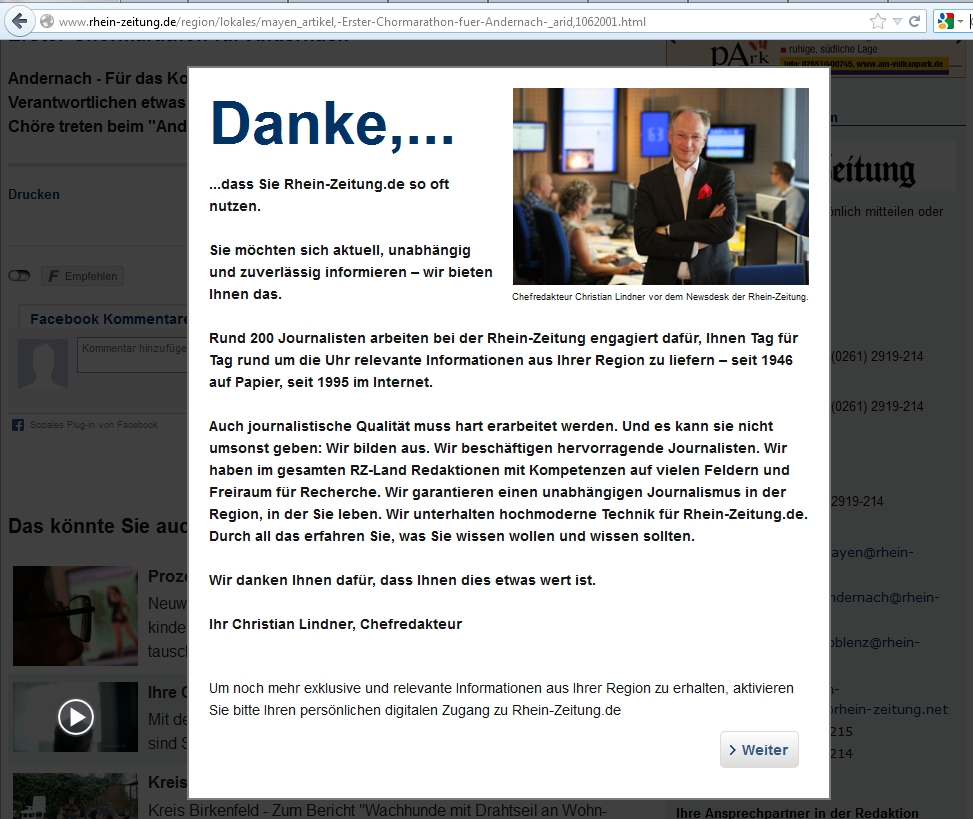Fakten sind Müll, sagt Constantin Seibt. Der Schweizer Journalist ist nach Berlin auf die re:publica gekommen, um über die Zukunft der Zeitung zu sprechen. Aber er beginnt erst mal mit der Vergangenheit: Damals, sagt Seibt, sei die wichtigste Aufgabe im klassischen Journalismus gewesen, einfach nur nichts falsch zu machen. Wer das schaffte, hatte keine Probleme: die Abonnenten waren zufrieden, weil sie nicht aufgeregt wurden. Langeweile als Existenzberechtigung: Goldene Zeiten.
Doch die sind lange vorbei. Seit es das Internet gibt, sind Nachrichten keine Ware mehr: es gibt sie überall, und es gibt sie umsonst. Und auch Meinung, so sagt Seibt ein Stück weit überraschend, kann kein Alleinstellungsmerkmal mehr sein. Sie sei zu beliebig, zu leicht herzustellen. stattdessen, meint er, müssten Zeitungen etwas entwickeln, das deutlich weiter geht als Meinung: Haltung.
Er meint das im Sinne einer tiefer reflektierten, durchdachteren Form von Standpunkt, als es der kleine Kommentar auf Seite 2 auszudrücken oder zu leisten vermag.
Es ist das eine These, die für den überregionalen Journalismus sicher in weit stärkerem Ausmaße gilt als für die klassische Lokalzeitung. Dennoch aber lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn letztlich ist einer der wichtigsten Gründe für den oft überraschenden Erfolg von nicht formal als Journalisten ausgebildeten Bloggern genau jenes stärkere Engagement für Themen, Akteure und Ziele, das sich der klassische Journalismus, sicherlich oft zurecht, selbst verbietet.
Hier brauchen wir vielleicht sogar eine neue Ethik des Journalismus, die die klassische, im deutschen Pressekodex niedergelegte Zurückhaltung dort aufgibt, wo man sich mit dieser Aufgabe nicht gleichzeitig noch weit größere Probleme an anderer Stelle erkauft. Das ist eine ebenso wichtige wie gefährliche Überlegung, die man mit allem zu Gebote stehenden Fingerspitzengefühl anstellen muss.
Eines jedoch ist sicher: wenn alles so bleibt, wie es ist, dann bleibt es nicht.